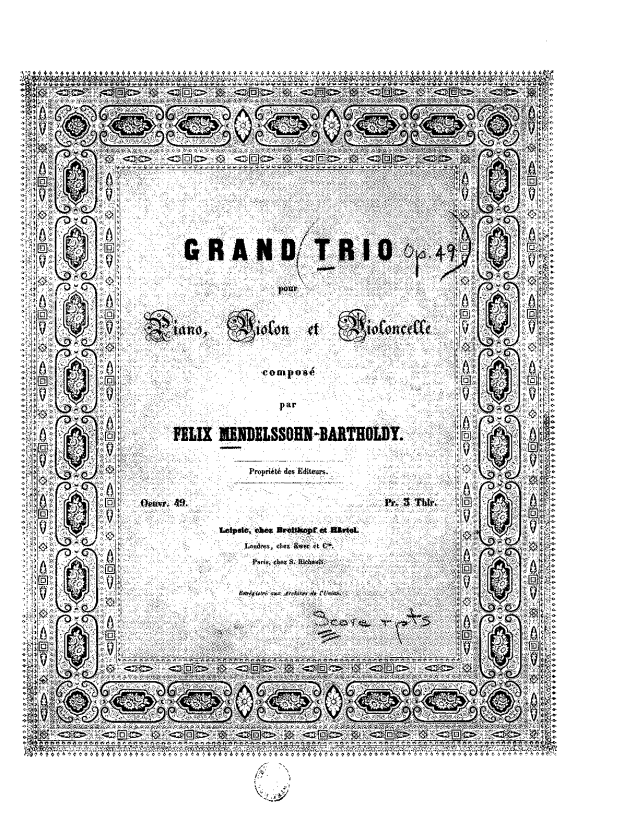Claus-Christian Schuster (CCS) im Gespräch mit Christian Baier (CB)
(Wien, Oktober 2000)
CB: Die Subventionskürzungen im Kulturbereich, die neben vielen anderen einschneidenden Maßnahmen den Weg zum Null-Defizit Österreichs flankieren, stellen vor allem die Basis und den Mittelbau der heimischen Kulturszene vor große Probleme. In welchen Bereichen ist die Tätigkeit dieser beiden tragenden Säulen der hiesigen Musiklandschaft durch den Wegfall von Förderungsmittel betroffen?
CCS: Die Änderung der Förderungspolitik ist auch eine gesellschaftliche Absichtserklärung. Diese gesellschaftliche Absichtserklärung ist nicht, wie viele andere politische Entscheidungen der letzten Zeit, von alltäglichen kleinen Bedürfnissen diktiert. Vielmehr ist dieser Wandel ein Ausdruck des geänderten gesellschaftlichen Selbstverständnisses. Die Änderungen der Förderungspolitik wirken sich auf alle Ebenen des kulturellen Lebens gleichermaßen aus. Zunächst beginnt es bei den kleineren Veranstaltern und Initiativen, bei den nicht so robusten Pflanzen auf dem Kulturboden. Dort sind die geänderten Bedingungen existenzbedrohend. Bei den großen Veranstaltern zeitigen die Kürzungen abernoch verheerendere Folgen, nämlich die Änderung des Erscheinungsbildes und der Zielsetzungen. Dies geschieht auf eine unumgängliche und unausweichliche Art und Weise. Die großen Veranstalter, die Träger der österreichischen Kulturszene, produzieren aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen immer mehr Events. Und was nicht Event ist, muß in Richtung Event kosmetisch gestylt werden. Dort, wo sich durch die Kürzungen die Tonart, in der gespielt wird, ändern muß, sehe ich – es mag jetzt grausam klingen – eine größere Gefahr für künstlerische und kulturelle Inhalte als dort, wo eine Kürzung das Aus, den raschen Tod bedeutet. Was verschwunden ist, ist ein Ton weniger im Akkord, aber was sich uns unter den Händen nach dem Wind dreht, wird den Klang unserer Kultur, also die Zukunft, bestimmen. Was das hierarchische Konzept, das Sie nicht zufälligerweise ansprechen, betrifft, so glaube ich, daß der Stellenwert der einzelnen künstlerischen Äußerung, der einzelnen kulturellen Initiative sich nicht errechnen läßt aus finanziellem Volumen, aus verkauften Eintrittskarten und Auslastungsquoten, sondern sich in einer viel gebrocheneren Form rechnet. Ich würde als ersten Verteidigungsschritt vorschlagen, daß wir uns von den hierarchischen Konzepten verabschieden. Ich plädiere für einen egalitäreren Umgang mit der Kunst.
CB: In den letzten Jahrzehnten haben kleine und große Veranstalter in einem Zubringer-Verhältnis kooperiert. Die kleinen Veranstalter haben – was den Wandel der Stile, der Ästhetik, der künstlerischen Ausdrucksformen betrifft – die subkutane Bildungs- und Aufklärungsarbeit geleistet, von der dann die großen Veranstalter profitierten. Wird diese Bildungsarbeit noch geleistet werden können, oder stehen am Schluß die großen Festivals vor leeren Sitzreihen, weil das Publikum wegbleibt, da es nicht mehr versteht, was ihm geboten wird?
CCS: Die Basisarbeit zur Weckung und Sensibilisierung des Publikums ist ein hehres und wunderbares Ziel. So könnte es funktionieren. Es wäre ein spiritueller Blutkreislauf. Oftmals war es aber in der Vergangenheit auch so, daß – selbst bei einem funktionierenden Subventionswesen – aus verschiedensten (nicht immer den niedrigsten) Motiven heraus ein Thema von der Spitze postuliert wurde, und dann eine ganze Reihe von Basisveranstaltern dieses Thema aufgegriffen und seine Aspekte aufgezeigt haben. Natürlich ist es auch gelungen, den Spieß umzudrehen, und von der Basis her ein Feld vorzubereiten, es zu pflügen, es aufnahmebereit zu machen und zu säen. Das wäre für mich der Inbegriff eines gesunden Kulturbodens. Wir leben allerdings in einer Situation, wo genau dieser Weg als Folge der pekuniären und gesellschaftlichen Bedingungen nur schwer begehbar ist. Die Frage stellt sich: Wie kann man die Funktionsweise der noch überlebenden Basisveranstalter und der ohnedies aus verschiedensten Gründen weiterhin bestehenden „Megaevent-Träger“ sodefinieren, daß trotzdem noch etwas Sinnvolles für das Kultur-Ganze entsteht? Da glaube ich, daß – ich bitte, mir das nicht als Zynismus auszulegen – die jetzt angespannte Situation eine große Chance für jene Initiativen beinhaltet, die aus einem wirklichen Bedürfnis und nicht aus – sagen wir es salopp – „G’schaftelhuberei“ entstanden sind. Man kann in einer Zeit, da die Subventionsgießkanne nicht mehr gleichmäßig den Boden der Musikkultur bewässert, sehr genau feststellen, wo es das Müssen gibt und wo bisher nur das Können war. Wenn diese Nagelprobe einmal durchgeführt wurde, und auf dem Kulturterrain einmal ausgesondert wurde, wo innere Anliegen vorhanden sind, und wo man sichKunst und Kultur nur zu ganz persönlichen und profanen Zwecken bedient. Da wird es entscheidend sein, daß neue Partnerschaften gesucht werden. Diese gewährleisten dann, daß solche Initiativen eine wirkliche Überlebenschance haben.
CB: Heißt das, die Privatwirtschaft von der Notwendigkeit eines Sponsorings zu überzeugen?
CCS: Das wird vielleicht in der Folge das Resultat dieses Denkprozesses sein. In erster Linie muß es das Ziel all dieser Initiativen sein, das Bedürfnis nach Inhalten und tiefergreifenden künstlerischen Aussagen zu wecken. Wir müssen wegkommen vom dekorativen Feierabendverständnis, mit dem Kultur gemeinhin behaftet ist. Allein die Geschichte des Konzertwesens belegt dieses Verständnis. Nietzsche spricht einmal von den Muße- und Verdauungsstunden des Geistes. Wir müssen uns vor Augen führen, wo es begonnen hat, daß Musik – wie alle anderen Künste auch – Gefahr läuft, nur mehr eine Verbrämung zu sein, die natürlich dann beim ersten Witterungsumschwung verzichtbar erscheint. Man wird – stellt man sich der Frage mit innerer Ehrlichkeit – bald darauf stoßen, daß es Bereiche gibt, in denen die geänderten gesellschaftlichen Realitäten so radikal kunstfeindlich sind, daß es ein Kampf gegen Windmühlen wäre, dort aus einem Justament-Standpunkt heraus Kultur durchsetzen zu wollen. Vor einem Vierteljahrhundert studierte ich in der damaligen Sowjetunion und mußte miterleben, wie man Künstler für nichtabsolvierte Konzerte bezahlte, weil sich die Mühen, den Saal zu heizen, bei einer geringen Publikumsanzahl nicht lohnte. Das ist für mich ein Beispiel von gogolscher Radikalität für einen Scheinbetrieb, in den sich Kunst hineinmanövrieren kann. Wenn man sich – siehe „Drittes Reich“ und die Devise „Kunst ins Volk“ – einbildet, man muß mit aller Gewalt etwas durchsetzen, was dem Rezipienten kein Bedürfnis ist, dann ist das Scheitern vorprogrammiert. Auf der anderen Seite wird man wohl erkennen, daß es gar nicht so winzige Bereiche unseres Gesellschaftslebens gibt, wo Bedürfnisse vital vorhanden sind, und wo man die inhaltliche Austrocknung, die mit dem Wort „Mega-Event“ ziemlich grauenerregend beschrieben ist, als Verlust empfindet. An diesem Punkt kann man als Veranstalter, als Interpret, als potentieller Sponsor ein reiches und weites Betätigungsfeld finden.
CB: Das Altenberg Trio Wien war und ist kein Ensemble, das sich nur auf das kammermusikalische Standard-Repertoire stützt.
CCS: Wir sind immer auchauf der Suche nach Werken, die – oft aus obskursten Gründen – verschüttet und nicht bekannt sind. Ich sehe als Interpret meine Aufgabe darin, ein Werk, dessen Bedeutung und Stellenwert ich erkannt habe, auch dort durchzusetzen, wo mir Widerstände in den Weg gelegt werden. Meine Erfahrungen mit Widerständen beziehen sich nicht nur auf neue und neueste Musik, sondern auch auf ältere und alte Musik. In Zukunft wird für Interpreten wichtig sein, sich intensiver als bisher noch mit Werken auseinanderzusetzen, den Staub vorangegangener Interpretationen wegzuwischen, die Patinaeingefahrener Hörgewohnheiten abzukratzen und dem Publikum einen unverstellten Blick auf die Komposition, also auf die Musik an sich, zu ermöglichen.
CB: Wird bei der derzeitigen Förderungssituation dieser Luxus des zweiten Blicks auf eine Komposition noch möglich sein?
CCS: Ich glaube, ohne vulgärdarwinistisch sein zu wollen, daß überall, wo die Ausübung von Kultur und das Leben mit Kultur ein vitales Bedürfnis sind, der künstlerische Wille nicht umzubringen ist. Schwierige Rahmenbedingungen haben oft – die Vergangenheit zeigt es – verschüttete Potentiale an Kreativität und Willenskraft mobilisiert, die sich für den nächstfolgenden Schritt, die Durchsetzung von Inhalten auch gegen bestehende Widerstände, als sehr segensreich erwiesen haben. Auf längere Sicht wird der Staat aber nicht umhin können, seine Förder- und Beschützeraufgabe, die er in meinem Staatsverständnis nach wie vor hat, auf eine diskrete Weise wahrzunehmen,mit der Fähigkeit, zu unterscheiden zwischen Luftblasen und Wurzeln.